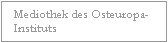Martin Wagner

Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin
Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Garystraße 55
Raum 111
14195 Berlin
Sprechstunde
Mittwoch, 15 Uhr. Bitte melden Sie sich per E-Mail an.
| Seit 1/2023 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Arbeitsbereich Geschichte des Osteuropa-Instituts, Freie Universität Berlin |
| 4–10/2024 | Elternzeit |
| Seit 2020 |
Redakteur für Geschichte Osteuropas bei H-Soz-Kult |
| 2023 | Promotion, Humboldt-Universität zu Berlin – Titel der Dissertation: „Kollektive Disziplinierung. Die Transformation totalitärer Herrschaft nach Stalin und Mao“; Forschungsaufenthalte in Moskau, St. Petersburg, Princeton und Hongkong; Tiburtius-Preis der Berliner Hochschulen 2024; Max-Weber-Preis für Nachwuchsforschung des Max-Weber-Kollegs der Universität Erfurt 2024 |
| 5/2018–12/2022 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas, Institut für Geschichtswissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin |
| 2018 | M.A. in Chinastudien, Freie Universität Berlin |
| 2017 | M.A. in Moderner Europäischer Geschichte, Humboldt-Universität zu Berlin; Humboldt-Preis für die Masterarbeit |
| 9/2016–7/2017 | Studien- und Forschungsaufenthalt an der Higher School of Economics Moscow |
| 2014 | B.A. in Geschichte und Sozialwissenschaften, Humboldt-Universität zu Berlin; währenddessen Gasthörer der Sinologie |
| 9/2012–8/2013 | Studienaufenthalt an der Peking Universität |
Sommersemester 2025
13247 (Seminar) - Die Russische Revolution als globales Ereignis (Do 8-10)
31203 (Seminar) - „Der Balkan beginnt am Wiener Rennweg“. Österreich-Ungarn als Vielvölkerimperium, 1867-1918 (Do 10-12)
Wintersemester 2024/25
31201 (Einführungskurs) - Osteuropa. Einführung in die Area Studies (Do 8-10)
31205 (Seminar) - Imperial Encounters: Russia, Japan, and China Scramble for Manchuria, 1850-1950 (Do 10-12)
Wintersemester 2023/24
31102 (Projektseminar) - Energie(n) und Ressourcen in Osteuropa (Fr 10-12)
31203 (Seminar) - Geschichte ist Gegenwart. Staat und Nation in der Ukraine (Do 10-12)
Sommersemester 2023
31203 (Seminar) - Feindstudien. Ost(mittel)europas Kommunisten beobachten China, 1969-1989 (Di 16-18)
13196 (Seminar) - Stalinismus. Dimensionen und Deutungen (Di 10-12)
Wintersemester 2022/23
31205 (Vertiefungsseminar) Moskau und Peking. Eine Beziehungsgeschichte 1689-2022 (Di 16-18)
Forschungsschwerpunkte (research focus)
- Russland/Sowjetunion und China im 19. und 20. Jahrhundert
- Transnationale und vergleichende Geschichte autoritärer Herrschaft
- Die post-totalitäre Transformation nach Stalin und Mao
- Diplomatiegeschichte der sino-sowjetischen Beziehungen
Forschungsprojekte
Mit Sören Urbansky: China und Russland. Kurze Geschichte einer langen Beziehung
In vier Jahrhunderten Nachbarschaft haben die Beziehungen zwischen China und Russland viel Licht und Schatten gesehen. Die Zeit der Glücksmomente war kurz. Sie endete oft unverhofft. Russland und China waren einander dabei ein stetes Gegenüber; ein Gegenüber, dem sie sich – ganz gleich ob in Freundschaft, Gleichgültigkeit oder Feindschaft – nicht entziehen konnten. Denn als imperiale Großreiche, sozialistische Supermächte, autoritäre Gewaltregime glichen sie einander, verglichen einander, konkurrierten und kooperierten, waren in Annäherung getrennt, in Abgrenzung geeint.
Vom Jahr 1689, als sie die gemeinsame Territorialgrenze zogen, bis in die Gegenwart des Jahres 2022, als sie territoriale und symbolische Grenzen überschritten, verband Russland und China eine wechselvolle Geschichte. Diese Interaktion war stets mehr als die Summe außenpolitischer Entscheidungen und diplomatischer Vereinbarungen. Sie ist die Geschichte von Wahrnehmungen und Einflüssen, vom Abarbeiten „am Anderen“ und zuweilen der Übernahme ins Eigene.
Promotion: Kollektive Disziplinierung. Die Transformation totalitärer Herrschaft nach Stalin und Mao
Totalitäre Regime können sich von innen heraus verändern und selbst mäßigen, sie können Gewalt und Willkür einhegen, die Allmacht des Einzelnen eingrenzen, und ihre Beziehung zu den Beherrschten neu begründen. Die poststalinistische Sowjetunion und das postmaoistische China sind zwei Beispiele dafür, wie der Terror aus dem Leben der Menschen verschwinden konnte, weil die Täter von einst nicht mehr in jener Ordnung leben wollten, an deren Schaffung sie selbst beteiligt gewesen waren.
Mit dem Tod Stalins im März 1953 und Mao Zedongs im September 1976 kam der Massenterror an ein Ende, nicht aber die Systeme, in deren Namen die Führer Furcht und Schrecken verbreitet hatten. Wie konnten die Gefolgsleute Stalins und Maos der Gewalt ein Ende setzen, ohne das Herrschaftssystem zu verändern? Und wie gelang es den Nachfolgern der Tyrannen, untereinander Frieden zu halten?
Sowohl in der Sowjetunion als auch im China vollzog sich der Herrschaftswandel von der Alleinherrschaft zu einer autoritären Ordnung im Modus der Krisenbewältigung einer so genannten „kollektiven Führung“. Wie unterschieden sich die Antworten, die die Erben der Macht in der Sowjetunion und China auf diese Herausforderung fanden? Lernten Moskaus und Beijings Reformer voneinander, grenzten sie sich voneinander ab?
Monographien
Herausgeberschaft
Aufsätze in begutachteten Zeitschriften und Sammelbänden
in Zeitschriften und Sammelbänden
in Tageszeitungen
in Internetpublikationen
Akademische Übersetzungen
Rezensionen
Interviews, Podcasts
Monographien
Kollektive Disziplinierung. Die Transformation totalitärer Herrschaft nach Stalin und Mao [Manuskript der Dissertation].
China und Russland. Kurze Geschichte einer langen Beziehung, Berlin: Suhrkamp Verlag 2025. (mit Sören Urbansky)
Sachbuchbestenliste, Deutschlandfunk Kultur, ZDF und DIE ZEIT, April 2025
Sachbuchbestenliste, Die Literarische Welt, RBB Kultur, Ö1 und NZZ, Mai 2025
Die zehn besten Bücher des Frühlings (Tagesspiegel, 22.3.2025, S. 14)
Herausgeberschaft
Besprochene Geschichte. Die Ukraine, Russland und die Sowjetunion in Buchrezensionen – ein Dossier von H-Soz-Kult, in: H-Soz-Kult, 29.07.2022, https://www.hsozkult.de/text/id/texte-5485?title=besprochene-geschichte-die-ukraine-russland-und-die-sowjetunion-in-buchrezensionen-ein-dossier-von-h-soz-kult (zusammen mit Helena Holzberger und Robert Kindler)
Crises in Authoritarian Regimes. Fragile Orders and Contested Power, Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag 2022. (zusammen mit Jörg Baberowski)
Hiroshima. Die Atombombe als Gegenstand der Globalgeschichte, in: Zeitgeschichte-online, April 2017, URL: http://www.zeitgeschichte-online.de/thema/hiroshima. (hg. v. Lutz Raphael und Jan Eckel unter Mitarbeit von Martin Wagner).
Aufsätze in begutachteten Zeitschriften und Sammelbänden
Rediscovering Lenin, Reinventing the Collective. Revolutionary Ideals in post-Stalinist and post-Maoist Transitions, in: Norihiro Naganawa (Hrsg.): Dreams of Emancipation. A Transnational History of Revolutionary Russia, Boston: Academic Studies Press 2024, S. 229–257.
Excoriating Stalin, Criticizing Mao. Entangled Reevaluations of the Past in the 1950s Soviet Union and 1970s/80s China, in: American Historical Review 128:3 (2023), S. 1105–1143.
Entanglement and Rivalry: Encountering “the Other” in Harbin’s Education, 1906–1932, in: Comparativ. Zeitschrift für Globalgeschichte und Vergleichende Gesellschaftsforschung 31: 5-6 (2021): Transimperial Histories of Knowledge: Exchange and Collaboration from the Margins of Imperial Europe, S. 639–653.
KPD-Verbot – KPÖ-Gebot. Antikommunismen und staatlicher Umgang mit Kommunistischen Parteien in den 1950er Jahren, in: Geschichte und Gesellschaft 47:3 (2021): Erfassung, Ordnung, Ausgrenzung, S. 438–466.
Scheine drucken, Schätze evakuieren. Kontingenzbewältigung in Russland angesichts der Bedrohung St. Petersburgs 1812, in: Historische Zeitschrift 312:1 (2021), S. 62–97. (zusammen mit Benjamin Conrad)
Revisionismus. Elemente, Ursprünge und Wirkungen der Debatte um den Stalinismus „von unten“, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 66:4 (2018), S. 651–681.
in Zeitschriften und Sammelbänden
Stalins Tod und das Ende der Allmacht. Zur Transformation totalitärer Herrschaft, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 73:20–21 (2023), S. 35–40.
Europe’s Other(ed)s: The Americas, Africa, Asia, and the Middle East in Contemporary History (ca. 1900-2000) in: Jan Hansen, Jochen Hung u.a. (Hrsg.): The European Experience. A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500–2000, Cambridge: Open Books Publishers 2023, S. 119–130. (zusammen mit Gabriela Lima, Ozan Ozavci und Balázs Sipo).
Europe’s Other(ed)s: The Americas, Africa, Asia, and the Middle East in Modern History (ca. 1800–1900), in: Jan Hansen, Jochen Hung u.a. (Hrsg.): The European Experience. A Multi-Perspective History of Modern Europe, 1500–2000, Cambridge: Open Books Publishers 2023, S. 109–117. (zusammen mit Ramachandra Byrappa, Jaroslav Ira und Ozan Ozavci).
Beides erschien zugleich als EuroClio-Textbuch: https://historiana.eu/narratives/europes-other-ed-s-1/start
Über die Trennung sprechen. Das Erbe der Entstalinisierung und das Ende der sino-sowjetischen Freundschaft 1963, in: Jörg Baberowski und Robert Kindler (Hrsg.): Jahrbuch für Historische Kommunismusforschung 2023, S. 75–92.
Crises in Authoritarian Regimes: An Introduction, in: Jörg Baberowski und Martin Wagner (Hrsg.): Crises in Authoritarian Regimes: Fragile Orders and Contested Power, Frankfurt am Main/New York: Campus Verlag 2022, S. 11–26. (zusammen mit Jörg Baberowski)
in Tageszeitungen
China und Russland – verfreundete Feinde, in: Neue Zürcher Zeitung, 15. Februar 2025, S. 19 (mit Sören Urbansky) (zugleich online: https://www.nzz.ch/meinung/verfreundete-feinde-das-verhaeltnis-zwischen-china-und-russland-ist-eine-entscheidende-determinante-der-weltpolitik-ld.1863033)
Moskau und Peking bleiben lustlose Verbündete, in: Der Standard, 14. Februar 2025, S. 25 (mit Sören Urbansky) (zugleich online: https://www.derstandard.at/story/3000000257137/moskau-und-peking-bleiben-unliebsame-verbuendete)
Wie endet Putins Herrschaft?, in: Neue Zürcher Zeitung, 10. Mai 2022, S. 28. (zugleich online: https://www.nzz.ch/feuilleton/putin-die-zeit-nach-stalin-zeigt-wie-sich-macht-wandeln-kann-ld.1682638)
Die Zukunft ist offen, und wir kommen nicht um sie herum: was wir aus einem Rückblick auf Napoleons Russlandfeldzug lernen, in: Neue Zürcher Zeitung, 17. April 2020. (online: https://www.nzz.ch/feuilleton/dcorona-krise-wir-kennen-die-zukunft-nicht-aber-gestalten-sie-ld.1550257)
Über Fehler sprechen, aber keine Fehler zugeben, in: Neue Zürcher Zeitung, 17. Januar 2019, S. 43. (zugleich online: https://www.nzz.ch/feuilleton/china-mao-ueber-fehler-sprechen-aber-keine-zugeben-ld.1451563)
„Mit Zunehmen der Unzufriedenheit ist das ein Risiko“. Der Leiter der EU-Kommissionsvertretung über die Gefahr von Massendemonstrationen und Radikalisierung als Folge der Finanzkrise, in: Der Standard, 30. März 2009. (online: https://www.derstandard.at/story/1237228684068/martin-wagner-mit-zunehmen-der-unzufriedenheit-ist-das-ein-risiko)
in Internetpublikationen
Seit an Seit auf dem Roten Platz: Xi und Putin im Schatten der Geschichte, in: China. Table 1074, 9.5.2025, https://table.media/china/standpunkt/seit-an-seit-auf-dem-roten-platz-xi-und-putin-im-schatten-der-geschichte/ (mit Sören Urbansky).
Zugleich auf Englisch erschienen: Side by side on the Red Square: Xi and Putin in the shadow of history, in: China. Table 1074, 9.5.2025, https://table.media/en/china/opinion/side-by-side-on-red-square-xi-and-putin-in-the-shadow-of-history/ (mit Sören Urbansky).
Navigating Ambivalence: China’s Strategic Calculations in the Ukraine War, in: Russian Analytical Digest 325 (2025): Russia’s International Allies and Partners, S. 10–14, https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/russiananalyticaldigest-325.pdf (mit Sören Urbansky).
Der Vergessenheit trotzen. Die historische Ukraine mit Andreas Kappeler entdecken (Rezensionsessay zu Andreas Kappeler: Kleine Geschichte der Ukraine. 5., überarb. und aktualisierte Auflage, München 2019), in: H-Soz-Kult, 23.3.2022, https://www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-116255.
Die Atombombenabwürfe auf Nagasaki und Hiroshima im August 1945: „Global Moments“?, in: Zeitgeschichte-online, April 2017, https://zeitgeschichte-online.de/themen/die-atombombenabwuerfe-auf-nagasaki-und-hiroshima-im-august-1945-global-moments (zusammen mit Kai Willms, Susanne Quitmann und Helge Jonas Pösche).
Bomben für den Frieden – Frieden ohne Bomben. Die Atombombe als Triebkraft der Ent- und Verflechtung internationaler Staatenbeziehungen, 1945–1968, in: Zeitgeschichte-online, April 2017, https://zeitgeschichte-online.de/themen/bomben-fuer-den-frieden-frieden-ohne-bomben (zusammen mit Helge Jonas Pösche).
Akademische Übersetzungen
ins Englische: Armin Nassehi: Emergency as Normalcy. An Afterword, in: Jörg Baberowski und Martin Wagner (Hrsg.): Crises in Authoritarian Regimes. Fragile Orders and Contested Power, Frankfurt am Main/New York 2022, S. 365–372. (zusammen mit Linda O’Grady)
aus dem Russischen: Auszüge aus Texten von L. I. Ginzberg, A. I. Danilov und L. Korsunskij zur Rezeption Friedrich Meineckes in der Sowjetunion, in: Bernd Sösemann (Hrsg.): Friedrich Meinecke: „Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen“. Edition und internationale Rezeption, Berlin 2018, S. 310–312, 357, 359–362.
aus dem Chinesischen: Auszüge aus Texten von He Zhaowu (何兆武), Shi Yonghe (石雍和), Li Yang (李扬), Zhang Guiyong (張貴永) und Xu Xianyao (徐先堯) zur Rezeption Friedrich Meineckes in der VR China und Taiwan, in: Bernd Sösemann (Hrsg.): Friedrich Meinecke: „Die deutsche Katastrophe. Betrachtungen und Erinnerungen“. Edition und internationale Rezeption, Berlin 2018, S. 44, 187–191, 354–358, 423.
Rezensionen
Graeme Gill: Collective Leadership in Soviet Politics, Basingstoke 2018, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 69:2 (2021), S. 331–332.
Daniel Leese: Maos langer Schatten. Chinas Umgang mit der Vergangenheit, München 2020, in: H-Soz-Kult, 25.5.2021, https://www.hsozkult.de/review/id/reb-94382?title=d-leese-maos-langer-schatten&recno=1&q=&sort=&fq=&total=17938
Jonathan Harris: Party Leadership Under Stalin and Khrushchev. Party Officials and the Soviet State, 1948-1964, Lanham u.a. 2018, in: Historische Zeitschrift 312:1 (2021), S. 267–268.
Kirill A. Abramjan: 1937 god. N.S. Chruščёv i moskovskaja partorganizacija, Moskva 2018, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas 68:3–4 (2020), S. 658–660.
Warren Sun und Frederick C. Teiwes: Paradoxes of Post-Mao Rural Reform. Initial Steps Toward a New Chinese Countryside 1976–1981, New York 2016, in: ASIEN – The German Journal on Contemporary Asia 156/157 (2020), S. 208–210.
Li Danhui/Xia Yafeng: Mao and the Sino-Soviet Split, 1959-1973: A New History, Lanham 2018, in: H-Soz-Kult, 11.12.2020, www.hsozkult.de/publicationreview/id/reb-93442
Wie die Grenze in die Steppe kam: Zwischen China und Russland war Niemandsland. Bis nationale Interessen ihre Spuren hinterliessen. (Besprechung zu Sören Urbansky: Beyond the Steppe Frontier. A History of the Sino-Russian Border, Princeton 2020), in: Neue Zürcher Zeitung, 12. November 2020. (online: https://www.nzz.ch/feuilleton/die-grenze-in-der-steppe-zwischen-china-und-russland-ld.1586208)
Ethan Pollock: Without the Banya We Would Perish. A History of the Russian Bathhouse, Oxford 2019, in: Historische Zeitschrift 311:2 (2020), S. 405–407.
Thomas Maissen/Barbara Mittler: Why China Did Not Have a Renaissance – and Why That Matters. An Interdisciplinary Dialogue, Berlin/Boston 2018, in: Das Historisch-Politische Buch 68:1 (2020), S. 83.
Benedikt Tondera: Reisen auf Sowjetisch. Auslandstourismus unter Chruschtschow und Breschnew, 1953–1982, Wiesbaden 2019, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 68:6 (2020), S. 585–587.
Daniel Leese/Puck Engman (Hrsg.): Victims, Perpetrators and the Role of Law in Maoist China. A Case-Study Approach, Berlin/Boston 2018, in: WerkstattGeschichte 81 (2020), S. 207–209. (zugleich online: https://www.recensio.net/rezensionen/zeitschriften/werkstattgeschichte/2020/81-1-2020/ReviewMonograph41356017)
Sammelrezension zu: Lucien Bianco: Stalin and Mao. A Comparison of the Russian and Chinese Revolutions. Transl. by Krystyna Horko, Hong Kong 2018; Elizabeth McGuire: Red at Heart. How Chinese Communists Fell in Love with the Russian Revolution, Oxford 2018, in: Historische Zeitschrift 310:1 (2020), S. 259–262.
Immo Rebitschek: Die disziplinierte Diktatur. Stalinismus und Justiz in der sowjetischen Provinz, 1938 bis 1956, Wien/Köln/Weimar 2018, in: H-Soz-Kult 28.05.2019, www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-29833
Kathleen E. Smith: Moscow 1956. The Silenced Spring, Cambridge, Mass./London 2017, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 67:1 (2019), S. 87–89.
Natal’ja Aleksandrovna Volynčik (Hrsg.): Posle Stalina. Reformy 1950-ch godov v kontekste sovetskoj i postsovetskoj istorii. Materialy VIII meždunarodnoj konferencii, Ekaterinburg, 15-17 oktjabrja 2015 goda, Moskva 2016, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas/jgo.e-reviews 8:4 (2018), S. 78–82, https://www.recensio.net/r/a0388246be8d4b2c99e04f5b2de302d5
Aleksandr A. Fokin: “Kommunizm ne za gorami”. Obrazy buduščego u vlasti i naselenija SSSR na rubeže 1950-1960-ch godov, Moskva 2017, in: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas/jgo.e-reviews 8:4 (2018), S. 29–31, https://www.recensio.net/r/bf9fb8f33ad547e28fe984b64546be88
Cheng Li: Chinese Politics in the Xi Jinping Era. Reassessing Collective Leadership, Washington 2016, in: ASIEN – The German Journal on Contemporary Asia 149 (2018), S. 146–148.
Sheila Fitzpatrick: Stalins Mannschaft. Teamarbeit und Tyrannei im Kreml. Übersetzt von Christiana Goldmann, Paderborn 2017, in: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 66:12 (2018), S. 1064–1066.
Joshua Rubenstein: The Last Days of Stalin, New Haven 2016, in: H-Soz-Kult 21.11.2018, www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-29936
Susanne Hohler: Fascism in Manchuria. The Soviet-China Encounter in the 1930s, London 2017, in: H-Soz-Kult 25.09.2018, www.hsozkult.de/publicationreview/id/rezbuecher-27236
Interviews, Podcasts
Podcast „Russlands übermächtiger Freund“, in: Die Zeit, Der Ostcast, 7. August 2025. (mit Sören Urbansky)
Interview „Putin und Xi: Wie gefährlich ist die Freundschaft wirklich für Deutschland?“, in: Der Westen, 20. Juni 2025. (mit Sören Urbansky)
Interview zu „China und Russland“, in: Der Westen, „Reden wir drüber!“, 14. Juni 2025. (mit Sören Urbansky)
Interview zu „China und Russland“, in: Einmischen! Politik Podcast, Nr. 284, 12.5.2025 https://podcaste97de5.podigee.io/314-deutsch-genug-und-eine-kurze-geschichte-von-russland-und-china (mit Sören Urbansky).
Interview „Putin hat sich böse verrechnet", in: t-online, 24.3.2025, https://www.t-online.de/nachrichten/ausland/krisen/id_100607632/russland-china-und-donald-trump-das-hat-putin-gar-nicht-noetig-.html.
Interview zu den Beziehungen zwischen China und Russland, in: BR Radio, Bayern 2, Die Welt am Morgen, Moderation: Rolf Büllmann, 10.03.2025, 7:09-7:16, https://www.br.de/radio/live/bayern2/programm/2025-03-10/3626339/#t=07:09:59.
Weltmacht-Duo oder Schein-Allianz? Chinas und Russlands fragiles Bündnis. Mit Sören Urbansky und Martin Wagner, in: Geschichte ist Gegenwart! Der History & Politics Podcast der Körber-Stiftung, 28.2.2025, https://podcasts.apple.com/de/podcast/weltmacht-duo-oder-schein-allianz-chinas-und-russlands/id1465706659?i=1000696780003.
„Chinesische Truppen in der Ukraine, das wäre ein Epochenwechsel“, Interview, in: Frankfurter Rundschau/Münchner Merkur/TZ/Westfälischer Anzeiger, 27.2.2025 (mit Sören Urbansky), https://www.fr.de/politik/chinesische-truppen-in-der-ukraine-das-waere-ein-epochenwechsel-zr-93597734.html.
CHINAHIRN fragt…Sören Urbansky und Martin Wagner, Autoren des Buches „China und Russland“, in: CHINAHIRN, 26.2.2025, https://www.chinahirn.de/2025/02/25/chinahirn-fragt-soeren-urbansky-und-martin-wagner-autoren-des-buches-china-und-russland/.
Interview über die Geschichtspolitik Wladimir Putins, in: Der Westen, 18.10.2024, https://www.derwesten.de/politik/stalin-russland-putin-propaganda-id301173317.html.
Fluchtpunkt Gegenwart. Osteuropageschichte seit dem russischen Angriffskrieg, in: Vergangenheitsformen. Der Redaktionspodcast von H-Soz-Kult, Staffel 1 - Episode 1, 28. Februar 2023 (mit Helena Holzberger), https://www.hsozkult.de/podcast/staffel-1/fluchtpunkt-gegenwart.