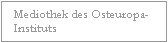Grete Rebstock

Dissertation: Stigma und Schweigen. NS-Zwangsarbeit aus sowjetischer Perpektive. Ein Beitrag zur Oral History
| 2021 | Abschluss der Promotion im Fach Neuere Geschichte an der Freien Universität Berlin. Promotionsthema: “Die Erinnerungen ehemaliger NS-Zwangsarbeiter_innen aus der Sowjetunion” (gefördert vom Evangelischen Studienwerk) |
| 2010–2012 |
Freie Mitarbeit im Online-Archiv „Zwangsarbeit 1939 – 1945. Erinnerungen und Geschichte“ |
| 2011 | Leitung des Seminars „Deutsche Erinnerungsorte“ für den DAAD in Taschkent |
| 2005–2006 | Auslandsstudienjahr an der Staatlichen Universität St. Petersburg, Russland |
| 2002–2010 | Magister-Studium Osteuropastudien und Ethnologie an der Freien Universität Berlin |
| Geboren am 22.12.1980 in Tübingen |
Abgeschlossenes Dissertationsprojekt: Stigma und Schweigen. NS-Zwangsarbeit aus sowjetischer Perpektive. Ein Beitrag zur Oral History
60 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges beantworten ehemalige sowjetische NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter Fragen zu ihrem erschütternden Schicksal einer doppelten Unrechtserfahrung: schuldlos schuldig unter den Nazis, dann unter den Sowjets. Die Analyse nähert sich aus unterschiedlichen Perspektiven diesen einzigartigen Interviews. So wird ersichtlich, wie der diskursive Hintergrund von 60 Jahren Geschichtspolitik die Erinnerungen der „Ostarbeiter“ prägte. Der Genderaspekt stellt besonders die Erfahrungen der Frauen heraus. Es geht aber auch um Emotionen und körperliche Erinnerung. Und zuletzt wird nach den Ressourcen gefragt, die diese Menschen durchhalten ließ. „Stigma und Schweigen“ – der Titel verweist dabei auf ein zentrales Ergebnis der Studie, das eine erschreckende Kontinuität von Sowjetzeiten bis ins heutige Russland aufzeigt.
-
Grete Rebstock: Ein Leben und keine Worte. Erinnerungen ehemaliger NS-Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter aus der Sowjetunion. In: Gehmacher, Johanna; Löffler, Klara (Hg.): Storylines and Blackboxes. Autobiografie und Zeugenschaft in der Nachgeschichte von Nationalsozialismus und Zweitem Weltkrieg. Wien: new academic press, 2017, S. 47-62.
- Grete Rebstock: Emotionen und Diskurse. Überlegungen zu den Erinnerungen ehemaliger NS-Zwangsarbeiter_innen aus der Sowjetunion. In: Alina Bothe, Isabel Christina Brüning (Hg.): Geschlecht und Erinnerung im digitalen Zeitalter. Neue Perspektiven auf ZeitzeugInnenarchive, Berlin: LIT Verlag 2015, S. 157-178.
- Grete Rebstock: Zagovorit' k koncu žizni: russkojazyčnye svidetel’stva iz onlajn-archiva „Prinuditel’nyj trud 1939-1945. Vospomoninanija i istorija“. In: NIC "Memorial" (SPB) (Hg.): Pravo na imja. Biografika XX veka. Sankt Peterburg 20-22 aprelja 2014, St. Petersburg: NIC "Memorial" 2015, S. 138-145. Link